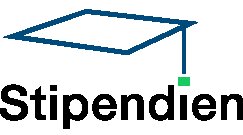Kompetenznetzwerk „Wissenschaft für den Wiederaufbau“ startet – Geschäftsstelle an der Hochschule Koblenz
17.02.2022
Hochschule| TOP |Verwaltung|Bauwesen / Bauingenieurwesen|Bauwesen / Architektur|RheinAhrCampus Remagen|RheinMoselCampus Koblenz|
Das Kompetenznetzwerk „Wissenschaft für den Wiederaufbau“ bringt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Land zusammen, die relevante Forschungs- und Transferthemen identifizieren und gemeinsam bearbeiten wollen, um damit zielgerichtet den Wieder- und Neuaufbau mit wissenschaftlicher Fachexpertise mittel- und langfristig zu begleiten. Zudem intensiviert es die Zusammenarbeit der Wissenschaft mit den betroffenen Kommunen und Landkreisen sowie mit den Behörden des Landes. Die grundsätzlichen Handlungsfelder, die sich bereits im Auftaktworkshop herauskristallisiert haben, sind die Wasserwirtschaft, die Kommunal- und Regionalentwicklung, die technische Infrastruktur sowie die Katastrophen- und Krisenprävention.
Herzstück des Netzwerkes ist die Geschäftsstelle an der Hochschule Koblenz, die in den kommenden Wochen am RheinMoselCampus Koblenz eingerichtet wird. Hinzu kommt eine Präsenz am RheinAhrCampus Remagen, um direkt vor Ort in den betroffenen Gebieten und damit auch nah an den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu sein. Zu den koordinierenden Aufgaben der Geschäftsstelle gehört unter anderem der Aufbau einer digitalen Plattform, um die wissenschaftliche Expertise zur Thematik Wiederaufbau sowie Katastrophenprävention und -bewältigung zu bündeln. Eine virtuelle Landkarte soll Aufschluss darüber geben, welche Fachkenntnisse an den wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes bestehen und wie diese in den Wiederaufbau einbezogen werden.
Die Geschäftsführung des Kompetenznetzwerkes „Wissenschaft für den Wiederaufbau“ übernimmt Prof. Ulrike Kirchner, emeritierte Professorin für Raum- und Umweltmanagement an der Hochschule Koblenz und frühere Planungschefin der Bundesgartenschau Koblenz 2011. Als wissenschaftlicher Leiter steht Prof. Dr. Lothar Kirschbauer zur Verfügung, der an der Hochschule Koblenz Siedlungswasserwirtschaft lehrt und der seine Expertise bereits in mehrere Forschungsprojekte zur Aufarbeitung der Flutkatastrophe einbringt. Dazu gehören etwa die beiden Projekte „Klimaanpassung, Hochwasser und Resilienz“ (KAHR) sowie „Urban Flood Resilience – Smart Tools“ (FloReST) zur Realisierung von Notabflusswegen in Wohngebieten, beide gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Teil des Teams werden zudem zwei wissenschaftlich Mitarbeitende sein, die jeweils eine halbe Stelle bekleiden. „Das Angebot des Kompetenznetzwerkes richtet sich vorrangig an alle relevanten Akteurinnen und Akteure in den von dieser Naturkatastrophe betroffenen Regionen“, betont Kirchner, „dabei blicken wir auch über die Landesgrenzen hinaus, indem wir den bundesweiten Austausch mit einschlägigen Wissenschaftseinrichtungen und Projekten suchen.“
Für Kirschbauer ist die Arbeit des Kompetenznetzwerkes die Grundlage für die Entwicklung und Realisierung präventiver Maßnahmen: „Eine der Lehren aus der Flutkatastrophe ist, dass die Entstehung von Hochwasserereignissen im Sinne einer planenden Vorausschau künftig räumlich engmaschiger und bereits in den Quellregionen der Einzugsgebiete beobachtet werden muss.“ Gemeinsam mit den Partnern im Kompetenznetzwerk möchte er dazu beitragen, das Ahrtal und die weiteren vom Hochwasser betroffenen Gebiete zu zukunftsfähigen Modellregionen weiter zu entwickeln. Auch eine Ausweitung der Analysen auf andere Regionen der Welt, die eine entsprechende Transferleistung erlauben, sei denkbar. „Dabei werden Querschnittsthemen und Megatrends beziehungsweise zentrale Zukunftsaufgaben wie Klimaanpassung und Digitalisierung jeweils in den Aktivitäten mitgedacht“, ergänzt Prof. Peter Thomé, der an der Hochschule Koblenz die Professur „Strategien Ländlicher Raum“ innehat und der die Arbeit des Kompetenznetzwerks auch in seine Lehre einbringt. So plant er im kommenden Sommersemester mehrere Projekt- und Masterarbeiten in der Verbandsgemeinde Altenahr in Kooperation mit der Hochschule Augsburg durchzuführen, bei denen es um klimagerechte Ortsplanung und Flächenarrondierung sowie um Instrumente zur mittelfristigen klimagerechten und resilienten Ortsentwicklung gehen wird.
Informationen zum Kompetenznetzwerk „Wissenschaft für den Wiederaufbau“ sind im Internet unter www.hs-koblenz.de/wfdw abrufbar.