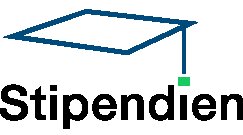Hochschulpreisverleihung im Historischen Rathaussaal
21.11.2013
Wieder einmal stellten Hochschulen aus Koblenz und Umgebung unter Beweis, wie vielfältig die Studienangebote in der Region sind, wie gut die Hochschulen untereinander vernetzt sind und wie Spitzenleistungen von Studierenden wahr genommen und auch prämiert werden. Den mit insgesamt 20.000 € dotierten Hochschulpreis stellt die Stiftung Zukunft der Sparkasse Koblenz sowie die Kreissparkasse Mayen zur Verfügung. Unterstützt wird die Veranstaltung seit vielen Jahren vom Kulturamt der Stadt Koblenz.
Ausgerichtet wurde sie diesmal von der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar (PTHV) im Verbund mit dem Förderkreis Wirtschaft und Wissenschaft in der Hochschulregion Koblenz. Dieser steht seit kurzem unter neuer Leitung des Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Koblenz, Matthias Nester. In seinem Grußwort betonte er die Bedeutung einer fruchtbaren Verbundenheit von Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Hierzu seien weitere Anstrengungen notwendig, um in Koblenz universitäres Leben auch in der Stadt spürbar werden zu lassen. Anerkennung und Dank sprach er dem scheidenden langjährigen Vorsitzenden des Fördervereins, Dr. h.c.mult. Karl-Jürgen Wilbert aus und nahm ihn und weitere Vertreter der „ersten Stunde“ als Ehrenmitglieder in den Vorstand auf.
Den Festvortrag zum Thema „Sprache und Gott. Was menschliche Rede und der Glaube an Gott miteinander zu tun haben“ hielt der Dekan der Vallendarer theologischen Fakultät, der Pallottiner Prof. Dr. Markus Schulze. Ausgehend vom Schriftzitat Im Anfang war das Wort“ plädierte er für ein vom menschlichen Bewusstsein bestimmtes Verständnis von Sprache. Nur so sind Worte offen für das wirkmächtige Handeln Gottes. Prof. Dr. Paul Rheinbay, Rektor der PTHV, führte dann durch die Kurzpräsentationen der Preisträger, jeweils zwei aus den größeren und einer aus den kleineren Hochschulen: Manfred Baumann ist Absolvent der pflegewissenschaftlichen Fakultät der PTHV. Er nähert sich in seiner Arbeit der menschlichen Einstellung, die mit „Palliative Haltung“ umschrieben wird. Wie im Namen schon ausgedrückt, geht es um eine innere Bezogenheit von Pflegekräften zum guten Sterben. Wichtiges Element dabei ist das „Zeit haben“, ein Anachronismus in der beschleunigten Moderne. Gerade hier liegt eine enorme Herausforderung für das um immer mehr Effizienz bemühte Gesundheitswesen.
Ein ebenfalls für öffentliche Brisanz sorgendes Thema behandelt Melanie Enders von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen. Sie schrieb über neue Ansätze in der Bürgerbeteiligung durch den Einsatz moderner Medien. Nach verschiedenen Erfahrungen mangelhaften Einbezugs der Bevölkerung bei Großprojekten („Stuttgart 21“, Hochmoselübergang) zeigt die Autorin auf, wie es besser gehen kann: Gerade neue Medien und Technologien ermöglichen eine Beteiligungskultur, bei welcher auch kritische Menschen den Weg zur letztgültigen Entscheidung als ausgewogen und fair bezeichnen können.
Dr. Klaas Dellschaft von der Uni Koblenz-Landau beschäftigt sich mit Verschlagwortungs-Techniken im Internet. So werden bei Suchmaschinen und sozialen Netzwerken dem Suchenden Stichworte vorgeschlagen, die von anderen Nutzern mit ähnlichem Interesse eingegeben wurden. Der Autor fand heraus, dass dies optimiert werden könnte, indem nicht fremde, sondern eher die eigenen bisher gebrauchten Stichworte vorgeschlagen werden. Die oft sehr komplexen Interaktionen zwischen Mensch und Technik im World-Wide-Web werden über Simulationsmodelle und Benutzerexperimente ein Stück verständlicher gemacht.
Gegen eine zunehmende Ökonomisierung im Bereich der Pädagogik wehrt sich Dr. Barbara Wolf - ebenfalls von der Uni Koblenz-Landau – in ihrer Arbeit über „Bildung, Erziehung und Sozialisation in der Frühen Kindheit“. Aktuelle Bildungsreformen haben die Betreuungsbedingungen in Kindertagesstätten verändert. Formalisierte Arbeitsschritte ersetzen oft pädagogisch wichtige Situationen des Alltags. Jedoch findet Bildung nicht erst dort statt, wo Prozesse dokumentiert und analysiert werden. Es geht der Autorin um die „Zwischen“ pädagogische Interaktion, die sie mit „Leibliche Kommunikation“ umschreibt.
In die Welt von Logistikunternehmen tauchen die Geschwister Lena und Sophia Wessling von der WHU Vallendar (Otto Beisheim School of Management) ein, die sich den Preis teilen. Ihre Arbeit über zentrale Funktionen von Kooperation untersucht notwendige menschliche Haltungen beim Eingehen einer strategischen Allianz – so der Visionär, der Administrator und der Vermittler. Dies wiederum hat dann Auswirkungen auf die Wahl des geeigneten Geschäftsführers, die sich sowohl nach der Größe wie auch der Rechtsform des einzugehenden Geschäftsbündnisses richtet.
Den Einfluss von Erfahrungen für die spätere Studien und Berufswahl bereits in Kindertagesstätten untersucht Astrid Scheuermann von der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen in ihrer Arbeit. Dabei konzentriert sie sich auf die sog. MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) Interviews mit Fachkräften und Pädagogik-Studierenden zeigen auf, wie wichtig bereits die Begeisterung im Kindesalter ist, um später dann auch entsprechende Ausbildungswege einzuschlagen. Als Ergebnis fordert sie zusätzliche Qualifizierungen von pädagogischen Kräften für diese Fächer, um der Fachkräftesicherung zu dienen.
Mit den Auswirkungen des demografischen Wandels für Betriebssportstätten beschäftigt sich Jens-Oliver Bludau von der Hochschule Koblenz. Im Rahmen seiner Arbeit entwickelte er für einen Firmensportverein mit ca. 9000 Mitgliedern ein zukunftsorientiertes Konzept, das besonders auf die älteren Sporttreibenden Rücksicht nimmt. Dabei geht es um die Gestaltung der Sportstätten, Programme außerhalb der eigentlichen Sportstunden, die Altersstruktur der Übungsleiter und nicht zuletzt auch um die Wohnortnähe der Angebote.
Zuletzt betrat Julia Hengster von der Hochschule Koblenz das Podium, um ihre Arbeit über eine Laborkonstellation für Strukturuntersuchungen bei Kristallverbindungen vorzustellen. Eine wichtige Rolle dabei spielen z.B. in der Chipindustrie benutzte sog. „Seltene-Erde-Verbindungen“. Der magneto-optische Zugang, deren Strukturen zu untersuchen, bietet ganz praktische Auswirkungen etwa auf die Erwärmung oder sogar auf die Lebensdauer der heute in der Medienwelt viel benutzten Materialien.
Nach der Präsentation der Arbeiten fand die feierliche Prämierung statt. Anschließend lud Klaus Weisbrod, Direktor der Mayener Verwaltungs-Fachhochschule, bereits für die Preisverleihung im nächsten Jahr, am 18. November, ein. Das Schlusswort sprach Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig und bat, unter zustimmendem Applaus der Festversammlung, zum von der Stadt gestifteten Imbiss.